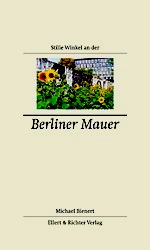KULTURMENSCHEN I JÜRGEN GOSCH
Gegen die Routine
von Michael Bienert
Es gibt seltene Theateraufführungen, in denen die Schauspieler nach antikem Vorbild starre Masken vor dem Gesicht tragen. Der ausdrucksstarke Kopf wirkt etwas zu groß auf dem Körper und scheint ihn in eine leicht gebeugte Haltung zu zwingen. An solche Kopfmenschen erinnert Jürgen Gosch, wenn er sich nach einer Premiere kurz dem Publikum zeigt. Der magere Leib im dunklen Pullover schleppt ein imposantes Philosophenhaupt auf die Bühne, die hohe Stirn wird von weißen Locken gerahmt. Der Mund über dem stachligen Doppelkinn ist verschlossen, die vorgeschobene Unterlippe kennt man von notorischen Skeptiker und trotzigen Kindern. In der zerfurchten, aber fast regungslosen Geschichtslandschaft wohnen zwei kleine, wasserhelle, lebhaft umherwandernde Augen.
Im Frühjahr hat es nicht geklappt, sich mit Jürgen Gosch in Berlin zu verabreden. Er sei schwer krank, hieß es, zwischendurch führte er Regie in Zürich und Hamburg. Gosch ist ein öffentlichkeitsscheuer Künstler. Man mag ihm nicht zudringlich hinterhertelefonieren, wartet lieber ab, bis überraschend die Berliner Akademie einen öffentlichen Auftritt ankündigt. Kurz vor seinem 65. Geburtstag wollen Freunde und Weggefährten den Regisseur würdigen. Der Zulauf an dem Abend ist enorm. Seit wenigen Jahren ist Jürgen Gosch der verlässlichste Erfolgsregisseur im deutschsprachigen Theater. Regelmässig werden seine Arbeiten zum Theatertreffen eingeladen, manchmal gleich im Doppelpack. Bei der letzten Kritikerumfrage von „Theater heute“ hat seine Inszenierung von „Onkel Wanja“ am Deutschen Theater in Berlin die Konkurrenz wieder weit hinter sich gelassen. Sie wurde nicht allein zur „Aufführung des Jahres“ gewählt, auch Goschs Protagonisten Ulrich Matthes (als Wanja), Jens Harzer (als Astrow) und Constanze Becker (als Jelena) dürfen sich „Schauspieler des Jahres“ nennen.
Der Regisseur jedoch ist ein großer Unbekannter geblieben: Er äußert sich am liebsten gar nicht über seine Arbeit und erst recht nicht über seine Person.
Auf dem Podium in der Akademie erwarten fünf Stühle vor einem schwarzen Vorhang seinen Auftritt. Das erinnert sofort an eine typische Gosch-Aufführung. Egal, ob er Shakespeare, Tschechow, Schimmelpfennig oder Yasmina Reza inszeniert, üblicherweise reichen ihm dafür ein schlichter sperrholzverkleideter Bühnenkasten von Johannes Schütz, ein paar Tische, Stühle und ein paar Requisiten. Meist bleibt das Saallicht während der Aufführung an, in der Akademie geht es langsam aus. Gosch aber lässt sich nicht sofort ins Rampenlicht führen. Er setzt sich mit übergeschlagenen Beinen in die dritte Publikumsreihe, um die ihm geltende Inszenierung erst mal auf sich wirken zu lassen.
Sein Kollege Thomas Langhoff erzählt, wie er in den Sechzigern gemeinsam mit Gosch am Theater in Potsdam anfing. „Eigenartig“ und „nicht zu beschreiben“ sei der junge Schauspieler Gosch damals gewesen. Dass er nur kleine Rollen bekam, habe er stoisch ertragen. Im Rundfunkarchiv der DDR lagern ein paar vergessene DDR-Fernsehfilme, die Langhoff seinerzeit mit Gosch drehte. Ein schmaler junger Mann ist da zu sehen, der mir kraftvoller Ruhe gebrochene Figuren verkörperte. Auf Langhoffs Frage, warum er bald mit der Schauspielerei aufgehört habe, antwortet Gosch: „Mir hats nie so wirklich gefallen. Komplizierter isses nicht.“ Punkt.
Seine erste Regiearbeit am DDR-Theater war ein Kindertheaterstück in Potsdam, die letzte 1978 eine von der Kritik als skandalös abgelehnte Inszenierung von Büchners „Leonce und Lena“ an der Berliner Volkbühne. Das SED-Parteiorgan „Neues Deutschland“ warf Gosch damals treffend vor, das witzig-melancholische Märchenlustspiel „auf Samuel Beckett hingewirtschaftet“ zu haben. Becketts absurdes Theater war in der DDR unerwünscht, während Büchner wegen seiner revolutionären Gesinnung als progressiver Autor kanonisiert war. Aus seinen Figuren Leonce und Valerio wurden ins Goschs Inszenierung zwei Clowns vom Schlage Wladimirs und Estragons in „Warten auf Godot“. Spielerisch handelte der Abend von Enge, Langeweile und Aussichtslosigkeit, wer wollte, konnte darin eine hinterhältige Zustandsbeschreibung des real existierenden Sozialismus erkennen.
„Diese Aufführung wird bestimmt verboten“, prophezeite der damals an der Volksbühne tätige Dramatiker Heiner Müller. Es kam schlimmer: Die Inszenierung verschwand ganz leise und allmählich aus dem Spielplan, der Regisseur Gosch bekam in der DDR keine Arbeit mehr.
Glücklicherweise waren Theater in der Bundesrepublik bereits auf das eigensinnige Talent aufmerksam geworden. Gosch bekam Angebote aus Hannover, Bremen, Köln und vom Hamburger Thalia Theater unter Jürgen Flimm. Den Wechsel in den Westen habe er weder als besonders befreiend noch als schmerzhaft empfunden, sagt Gosch. Seine Generation habe sich weniger politisch verstanden als Heiner Müller, aber: „Der Alltag in der Bundesrepublik erschrak einen auf andere Weise genauso wie die DDR“.
Auch im Westen eckte er mit störrischen Inszenierungen an. Seine Kunst des Weglassens, seine Suche nach dem Wesentlichen empfanden viele Kritiker und Zuschauer als schulmeisterliche Strenge. 1988 wurde Gosch als Nachfolger von Peter Stein und Luc Bondy in die kriselnde Direktion der Berliner Schaubühne geholt, doch schon sein Einstand als Regisseur mit „Macbeth“ geriet zum Fiasko. Über diese Regiearbeit schrieb der „Spiegel“: „Ein Pedant hatte dem Stück von Ehrgeiz und dämonischer Prophetie, von alpträumender Machtgier und mordstiftender Liebe rechthaberisch und besserwisserisch jegliches Leben ausgetrieben, hatte es in eine gestelzte Übersetzung, in lächerliche Kostüme, in eine geschwollene Diktion und in hölzerne Bewegungen und Gesten gepreßt - bis es seinen Geist aufgab und im Zeitlupentempo von halb acht bis zwölf Uhr verröchelte“. Nicht nur die Kritiker schäumten, das verwöhnte Schaubühnenpublikum verließ scharenweise die Aufführung.
In Goschs Künstlerlaufbahn markiert das Drama „Macbeth“ den Tiefpunkt - und steht zugleich für seinen größten Triumph. Mutig wagte er sich 2005 am Düsseldorfer Schauspielhaus noch einmal an das Stück. Diesmal entfesselte er einen Hexensabbat mit sieben weitgehend nackten Schauspielern, die kübelweise Theaterblut übereinander ausgossen und die Bühne in ein glitschiges Trümmerfeld verwandelten. Mit unerhörter Freiheit bewegten sich die Spieler, an der Spitze Ernst Stötzner als grauzotteliger Theaterkönig, in einem Raum jenseits aller Theaterkonventionen. Auch diesmal verließen Zuschauer die Premiere. Gosch löste eine „Ekeltheaterdebatte“ im Feuilleton aus, die jedoch zu seinen Gunsten verlief: Die Fachkritiker wählten Goschs Blutritual 2006 zur „Aufführung des Jahres“.
„Die Unzufriedenheit mit dem Bestehenden und die beharrliche Suche nach dem, was noch nicht da ist, das ist es, was Jürgen Gosch ausmacht“, sagt Thomas Langhoff. Mit den Jahren scheint Gosch seinen Weg gefunden zu haben, der mit großer Treffsicherheit zu spannenden Inszenierungen führt - ohne dass seine Mitstreiter genau sagen könnten, wie sie funktioniert. Denn auch auf den Proben sind von Gosch nie programmatische Sätze zu hören, die man getrost nachhause tragen könnte. Es gibt keine langen Diskussionen über die Stückinterpretation oder das Regiekonzept. Trotzdem gelingt es Gosch, Vertrauen zu schaffen und den Schauspielern ein Gefühl von Sicherheit mit auf den Weg zu geben. Ulrich Matthes rühmt Goschs Fähigkeit, seine Akteure auf den Proben offen, wach und neugierig zu beobachten. Er lege ihnen keine straffen Zügel an, sondern schaffe ein Gefühl von Freiheit und Mitverantwortung für die Arbeit. Gosch sei geschmackvoll, metiersicher und besitze einen sehr feinen Humor.
Streng und klar wirken Gosch-Aufführung auf die Zuschauer, aber nicht leblos. Meist guckt man in einen kahlen, hell ausgeleuchteten Bühnenkasten, es gibt kaum Lichtwechsel. Die Spieler haben keinen Rückzugsort, sie klettern aus der ersten Reihe auf die Bühne oder stehen wie bei „Onkel Wanja“ ringsum an den Wänden, wenn sie keinen Auftritt haben. Sie schminken sich selbst und rücken sich ihr Szenenbild eigenhändig zurecht. Das alles scheint die Schauspieler nicht zu belasten, im Gegenteil. Es schafft eine Sicherheit und eine Konzentration, die ein hohes Maß an Spontaneität in jeder Aufführung ermöglicht.
Damals an der Volksbühne bei „Leonce und Lena“ habe er bei der ersten Probe das Nicht-Spielen gelernt, erzählt der Schauspieler Michael Gwisdek. Er hatte seinen Text vorher im Kopf und sich darauf vorbereitet, vorn an der Rampe im weißen Rüschenhemd den Zuschauern zu zeigen, was ein Prinz ist. Der Regisseur Gosch sagte lange nichts, schaute nur, dann bat er den Schauspieler, nach und nach seine Jacke, Hemd und Hose auszuziehen, bis er in Unterhose dastand. Die Probe endete in einem wilden Clinch mit seinem ebenfalls spärlich bekleideten Partner Hermann Beyer. Wohin das führen würde, wussten beide nicht. „Aber ich hatte nie wieder Lust, die Rampensau zu spielen“, erzählt Gwisdek.
Versierte Stars wie Ulrich Matthes oder Corinna Harfouch, die sich in „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ am Deutschen Theater einen messerscharfen Ehekrieg liefern, verehren Gosch, weil er sie konsequent davor schützt, in Routine zu verfallen. Zuschauer und Kritiker zwingt Gosch, genau hinzusehen und hinzuhören. Auf das hochgerüstete Theater der technischen Effekte reagiert er mit Reduktion, das heißt Schärfung der Wahrnehmung für das, was die Menschen auf der Bühne einander antun.
Jürgen Gosch hat enorm viel in den letzten Jahren inszeniert. „Weil ich Lust auf die Arbeit hatte und weil ich Lust auf das Geld hatte“, sagt er lapidar. Das ist wieder so ein Satz, der zur Maske des skeptischen Philosphen gehört und das empfindliche Innenleben des Künstlers schützt. Eigentlich wollte er in diesem Herbst einen ganzen „Faust“ am Wiener Burgtheater inszenieren, doch dieses Mammutprojekt musste er krankheitshalber absagen. Jetzt steckt er in den Endproben zu Tschechows „Möwe“ in Berlin. Die Inszenierung sollte im frisch sanierten Deutschen Theater über die Bühne gehen, aber die Bauarbeiten dort schleppen sich hin. Und so schließt sich nun ein Kreis, denn Premiere ist am 20. Dezember ersatzweise in der Volksbühne, genau dort wo vor 30 Jahren Goschs Karriere als DDR-Regisseur unfreiwillig endete.
Den Kritikern hat Gosch durch seine Beharrlichkeit Respekt abgezwungen, das Publikum hat sich an seine störrische Verweigerung gegenüber Erwartungshaltungen gewöhnt. Geliebt wird er von den Schauspielern, die bei ihm aufblühen. Neulich in der Akademie der Künste sangen Ulrich Matthes, Ernst Stötzner und Corinna Harfouch ihrem Regisseur nacheinander ein Ständchen. Sie hatten ihre Darbietungen absichtlich nicht geprobt, weil sie nur zu genau wussten, wie sehr Gosch fertig einstudierte Auftritte verabscheut. Die Methode funktionierte, es passierte etwas Unerhörtes. Ulrich Matthes hob zaghaft an: „Der Mond ist aufgegangen“. Und ohne dass irgend jemand die Zuschauer aufgefordert hätte, hallte es vielstimmig durch den Saal: „Die goldnen Sternlein prangen / Am Himmel hell und klar.“
ERSTDRUCK: STUTTGARTER
ZEITUNG vom 13. Dezember 2008
© Text und Foto: Michael Bienert
Michael Bienert
Stille Winkel an der
Berliner Mauer
Ellert & Richter Verlag
Hamburg
ISBN: 978-3-8319-0365-8
144 Seiten mit
23 Abbildungen
und 2 Karten
Format: 12 x 20 cm;
Hardcover mit
Schutzumschlag
Preis: 12.95 EUR
Stille Winkel an der
Berliner Mauer
Ellert & Richter Verlag
Hamburg
ISBN: 978-3-8319-0365-8
144 Seiten mit
23 Abbildungen
und 2 Karten
Format: 12 x 20 cm;
Hardcover mit
Schutzumschlag
Preis: 12.95 EUR
Der Regisseur Jürgen Gosch starb am 11. Juni 2009 in seiner Berliner Wohnung. Seine letzten Arbeiten und Auftritte in der Öffentlichkeit hat Michael Bienert für die STUTTGARTER ZEITUNG aufmerksam verfolgt. Hier finden sie außer einem Porträt auch einen ausführlichen Nachruf vom Dezember 2008, sowie Besprechungen wichtiger Inszenierungen von Jürgen Gosch. Darunter seiner letzten Regiearbeit Idomeneus am Deutschen Theater, und seiner inzwischen bereits legendären Möwe an der Volksbühne. Außerdem von Wer hat Angst vor VirginaWoolf?, von Onkel Wanja, von Das Reich der Tiere, von Ein Sommernachtstraum, von Auf der Greifswalder Straße und Im Schlitten Arthur Schopenhauers.