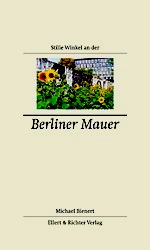NACHRUF I JÜRGEN GOSCH
Auf dem Spielplatz
von Michael Bienert
Wenn
Kinder miteinander spielen und sich in Räuber, Ritter oder Indianer
verwandeln, dann braucht es keinen Regisseur, kein perfektes Bühnenbild
oder echt aussehende Kostüme. Das Spiel funktioniert - allein durch
Fantasie und Verabredung. Es kann hinreißend komisch sein, und manchmal
endet es mit echten Tränen. Jürgen Gosch hat seine beiden jüngsten
Kinder gern auf Spielplätze begleitet. „Ich könnte dort Tage
verbringen", sagte er in einem Interview. In Theateraufführungen ging dieser Regisseur hingegen nur ungern. Er
empfand eine Art Scham, wenn er die Bemühungen auf der Bühne sah, ein
abgekartetes Spiel zu wiederholen. Gosch suchte nach einem Weg,
möglichst viel von der Spontaneität und Anarchie eines
Kinderspielplatzes in den Theaterbetrieb zu retten. Dazu reduzierte er
den Apparat auf das Allernotwendigste. Von dem Bühnenbildner Johannes
Schütz ließ er sich fast leere Räume bauen, in denen die Schauspieler
bei Bedarf Stühle und Tische rückten, sich umkleideten oder
splitternackt mit Farbe bemalten. Oft genügte ihm eine einzige
Lichtstimmung für eine ganze Aufführung. Auch im Zuschauerraum blieb
das Saallicht meistens an. Keine Sekunde ließ Gosch die Illusion zu,
man befinde sich an einem anderen Ort als eben im Theater.
Er verwandelte es in ein Spielzimmer, in dem sich Unvorhersehbares,
Unerhörtes, Staunenswertes ereignete. Eine nackte Männerhorde vergoss
kübelweise Theaterblut, beschmierte sich mit Fäkalien und zerlegte
Tische und Stühle zu einem glitschigen Trümmerhaufen, wie in Goschs
Düsseldorfer „Macbeth"-Inszenierung. In Roland Schimmelpfennigs „Reich
der Tiere", inszeniert am Deutschen Theater in Berlin, gönnte Gosch den
Zuschauern das Vergnügen, den nackten Schauspielern bei der
Ganzkörperbemalung und Verwandlung in ein Zebra, eine Wildkatze oder
einen Marabu zuzusehen. Auch dabei hatte man nie das Gefühl, den
Schauspielern werde etwas aufgezwungen. Unschuldig wie die Kinder
suhlten sie sich in der Farbe - und duschten sie am Ende des Spiels auf
offener Bühne wieder ab.
Das Vermeiden der Illusion war bei Gosch nicht nur eine Stilfrage,
schon gar keine Masche oder die Demonstration einer asketischen
Theatertheorie. Seine Konzentration auf das Wesentliche des Theaters
brachte die Schauspieler zum Leuchten, egal, ob es
Schauspielschulabsolventen waren oder mit allen Wassern gewaschene
Bühnenstars wie Ulrich Matthes und Corinna Harfouch in „Wer hat Angst
vor Virgina Woolf?". Gosch gab ihnen Raum, aus Routine und Konvention
auszuscheren und sich in Neuland vorzutasten, nicht nur während der
Proben, sondern auch während späterer Aufführungen. Statt eines
Konzepts entwickelte Gosch mit den Schauspielern ein möglichst zartes,
aber reißfestes Netz von Verabredungen. „Wenn man an der Aufführung
ablesen kann, dass sie nicht inszeniert wurde, sondern aus dem Spielen
entstanden ist, dann freut mich das", hat Gosch einmal gesagt. Ulrich
Matthes sprach von enormer Freiheit und Mitverantwortung, die der
Regisseur den Schauspielern übertrug.
Illusionslosigkeit zeichnete nicht nur seine Theaterästhetik aus,
sondern auch seine Weltsicht. Sie rührte her vom Blick eines Kindes,
das im zerstörten Nachkriegsberlin aufwuchs. Gosch wurde 1943 geboren,
der Vater kehrte nicht aus dem Krieg zurück. Das Karge und Harte der
Jugendjahre im russisch besetzten Ostberlin färbte sogar noch seine
späten Tschechow-Inszenierungen. Tschechows unbarmherzige Genauigkeit
und liebevolle Zugewandtheit bei der Menschendarstellung war dem
Regisseur nah.
Seine Verachtung jedweder Ideologie brachte ihn zwangsläufig mit den
Kunstaufsehern in der DDR in Konflikt. An der Berliner Volksbühne, wo
seine Karriere als Schauspieler und Regisseur begann, sorgte Gosch 1978
mit einer fatalistischen Inszenierung von Büchners „Leonce und Lena"
für Empörung. In der Bundesrepublik war man zum Glück schon auf das
störrische Talent aufmerksam geworden, bei Jürgen Flimm in Köln und
Hamburg konnte der Regisseur weiterarbeiten. Seine nüchternen und
sperrigen Inszenierungen wurden respektiert, doch auch als langweilig
und puritanisch angefeindet.
1988 scheiterte Gosch an der Berliner Schaubühne als Nachfolger Peter
Steins, der die künstlerische Leitung aufgegeben hatte; sein
reduktionistisches Vorgehen war am Haus des ruhmreichen Vorgängers
nicht durchzusetzen. Nach der Wiedervereinigung fand Gosch am Deutschen
Theater unter der Leitung Wolfgang Langhoffs eine neue Heimat, wurde
aber das quälende Gefühl nicht los, den richtigen Ton immer wieder zu
verfehlen: „Ich habe mich durchgeschämt und so durchgearbeitet bis zum
Ende."
Aus der langen künstlerischen Krise ging Gosch wie befreit hervor. Er
fand eine neue Balance zwischen seinem starken Formbewusstsein und dem
Zulassen von kreativer Anarchie auf den Proben. Seit 2004 wurden
jährlich Inszenierungen von Gosch zum Theatertreffen eingeladen,
manchmal gleich zwei. Gosch setzte die Maßstäbe, an denen sich der
übrige Theaterbetrieb messen lassen musste. Überschattet wurden diese
späten Triumphe durch eine fortschreitende Krebserkrankung des
Regisseurs, die seine Schauspieler noch mehr anspornte, über ihre
Grenzen zu gehen.
Die Begegnung mit Jürgen Gosch habe das eigene Leben verändert, sagen
viele, die in den letzten Jahren mit ihm gearbeitet haben. Seine Suche
und seine Konzentration auf das Wesentliche des Theaters hatte eine
reinigende Wirkung: auf die Schauspieler, auf das Publikum, auch auf
eine in ihren ästhetischen Maßstäben verunsicherte Theaterkritik. Das
wird über seinen Tod hinaus nachwirken. In der Nacht zu Donnerstag ist
Jürgen Gosch seiner Krankheit erlegen, er wurde 65 Jahre alt. Sollte es
auch im Theaterhimmel einen Kinderspielplatz geben, dann wird man
Jürgen Gosch jetzt dort finden.
ERSTDRUCK:
STUTTGARTER ZEITUNG vom 12. Juni 2009
Stille Winkel an der
Berliner Mauer
Ellert & Richter Verlag
Hamburg
ISBN: 978-3-8319-0365-8
144 Seiten mit
23 Abbildungen
und 2 Karten
Format: 12 x 20 cm;
Hardcover mit
Schutzumschlag
Preis: 12.95 EUR
Der Regisseur Jürgen Gosch starb am 11. Juni 2009 in seiner Berliner Wohnung. Seine letzten Arbeiten und Auftritte in der Öffentlichkeit hat Michael Bienert für die STUTTGARTER ZEITUNG aufmerksam verfolgt. Hier finden sie außer einem Nachruf auch ein ausführliches Porträt vom Dezember 2008, sowie Besprechungen wichtiger Inszenierungen von Jürgen Gosch. Darunter seiner letzten Regiearbeit Idomeneus am Deutschen Theater, und seiner inzwischen bereits legendären Möwe an der Volksbühne. Außerdem von Wer hat Angst vor VirginaWoolf?, von Onkel Wanja, von Das Reich der Tiere, von Ein Sommernachtstraum, von Auf der Greifswalder Straße und Im Schlitten Arthur Schopenhauers.