Tierrassen und Pflanzensorten sterben aus. Das gilt besonders für jene Pflanzen, die kultiviert werden und die der Ernährung dienen. "Während die Menschen sich früher von mehreren tausend Nutzpflanzenarten ernährten, lebt die Menschheit heute von rund 150 Arten, die Mehrheit der Weltbevölkerung sogar von nur zwölf", heißt es bei der Welternährungsorganisation FAO in Rom.
 Als die "sieben Säulen der Welternährung" listet die FAO Weizen, Reis, Mais, Knollenfrüchte - wie Cassava (auch Maniok oder Yuca) oder Taro - Kartoffeln, Zucker und Soja auf. Feldfrüchte allerdings, die nur schwer statistisch erfassbar sind, weil sie überwiegend in Hausgärten von Frauen angebaut und lokal konsumiert werden, sind in dieser Reihe bedeutender Nahrungspflanzen vernachlässigt. Dazu gehört die Gemüsebanane, die beispielsweise in Ostafrika rund 25 Prozent des
dortigen Kalorienbedarfs deckt.
Als die "sieben Säulen der Welternährung" listet die FAO Weizen, Reis, Mais, Knollenfrüchte - wie Cassava (auch Maniok oder Yuca) oder Taro - Kartoffeln, Zucker und Soja auf. Feldfrüchte allerdings, die nur schwer statistisch erfassbar sind, weil sie überwiegend in Hausgärten von Frauen angebaut und lokal konsumiert werden, sind in dieser Reihe bedeutender Nahrungspflanzen vernachlässigt. Dazu gehört die Gemüsebanane, die beispielsweise in Ostafrika rund 25 Prozent des
dortigen Kalorienbedarfs deckt.
Maßgeblich verantwortlich für den Verlust der Biodiversität bei Nutzpflanzen: neben der Umweltzerstörung durch Luftverschmutzung, Raubbau, klimatische Veränderungen und Ozonbelastung besonders die industrielle Landwirtschaft. Die in den vergangenen 20 Jahren durch Saatgut-Konzerne eingeführten neuen Kulturpflanzensorten, die vor allem auf hohe Erträge hingezüchtet wurden, haben die Vielfalt traditioneller Landsorten verdrängt.
 Diese Erosion schreitet auch heute noch fort. In den nächsten 30 Jahren wird weltweit etwa ein Viertel aller Pflanzenarten ausstreben. Was schwindet, sind jedoch nicht nur einzelne Arten selbst. Schneller noch verarmt der Reichtum innerhalb der Arten, die Sorten oder sogenannten Varietäten. Deren Vielfalt und
Verschiedenheit aber ist notwendig, damit ein natürliches Anpassungspotential, etwa bei Veränderungen der Umwelt, erhalten bleibt.
Diese Erosion schreitet auch heute noch fort. In den nächsten 30 Jahren wird weltweit etwa ein Viertel aller Pflanzenarten ausstreben. Was schwindet, sind jedoch nicht nur einzelne Arten selbst. Schneller noch verarmt der Reichtum innerhalb der Arten, die Sorten oder sogenannten Varietäten. Deren Vielfalt und
Verschiedenheit aber ist notwendig, damit ein natürliches Anpassungspotential, etwa bei Veränderungen der Umwelt, erhalten bleibt.
So haben ZüchterInnen und BäuerInnen in Nord und Süd seit langem Pflanzen mit besonderen Eigenschaften in bezug auf Wachstum und Reifezeit oder auf Resistenzen gegen Trockenheit, Insekten- oder Pilzbefall, Herbizidtoleranz und vieles mehr selektiert und in andere Kulturpflanzen eingekreuzt. Mannigfaltigkeit in der Landwirtschaft ist auch heute eine unschätzbare Absicherung gegen zukünftige Mißernten. Uniformität kann bald schon die Grundlagen der Welternährung gefährden.
Das Vorkommen und die Formenvielfalt von Nutzpflanzenarten, geschaffen in Tausenden von Jahren der Ackerbaukultur, ist allerdings höchst ungleichmäßig über den Globus verteilt. Wie wenige dieser Arten dabei ursprünglich in den gemäßigten Klimazonen des Nordens beheimatet sind, das fand in den zwanziger und dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts der sowjetische Pflanzenforscher Nikolaj Iwanowitsch Vavilov heraus.
Bei seinen umfangreichen botanischen Expeditionen, die ihn in den Nahen Osten, nach Afrika, Süd- und Nordamerika und nach Asien führten, sammelte und kartierte Vavilov Anbausorte für Anbausorte: vom Rettich bis zum Weizen, von der Gerste bis zur Kartoffel. So kam er zu dem Schluß, "daß der Grad an Vielfalt ein Indiz dafür sei, wie lange ein Fruchtart in der betreffenden Gegend kultiviert wurde", berichten die Agrarexperten Pat Mooney und Cary Fowler in ihrem Buch "Die Saat des Hungers": Je länger eine Fruchtart angebaut wurde, desto größer ihre Vielfalt. Diese Zentren der Formenvielfalt einer Pflanzenart bezeichnete Vavilov als "Ursprungszentren".
Nachfolgende Generationen von ForscherInnen bestätigten auch seine weitere These, die Gebiete mit reichster Artenvielfalt fänden sich etwa südlich des 40. Breitengrades. In diesen - überwiegend in Ländern des Südens liegenden - Regionen, wachsen mannigfache Kultursorten von Nutzpflanzen und oft auch deren wilde Verwandte. Über koloniale Handelsströme und im Gepäck von MigrantInnen wanderten sie von Region zu Region:
Getreidearten wie Gerste, Weizen und Hafer und einige Hülsenfrüchte kamen wohl aus dem Nahen Osten und Äthiopien nach Europa, ebenfalls aus Äthiopien stammt der Kaffee; Bohnen sind ursprünglich in Mexiko und weiter südlich heimisch, viele wilde Tomatensorten finden sich im Andenraum; aus Südostasien stammen Arten wilder Bananen, deren eßbare Sorten inzwischen auch in anderen subtropischen Regionen kultiviert werden; Reis ist zwischen Ostindien und Südchina zuhause; Mais wurde zuerst von den BäuerInnen Zentralamerikas kultiviert und wächst seit einigen hundert Jahren auch in Afrika, und die Sojabohne reiste in den letzten 500 Jahre von Asien aus nach Amerika ein.
Daß eingeführte Nutzpflanzenarten seit einigen Jahrhunderten Europas Speisezettel anreichern, mag beim Blick auf einstmals exotische Früchte wie Bananen, Kakao oder Kaffee heute noch nachvollziehbar sein. Doch auch die Kartoffel, mittlerweile Synonym für gutbürgerliche österreichische wie deutsche Küche, kam vor rund 400 Jahren aus den Anden hierher, und selbst Italiens "traditionelles" Gericht besteht aus zugereisten Pflanzen: Tomaten aus der Neuen Welt, kombiniert mit Pasta, deren Grundlage, der Weizen, aus dem Nahen Osten stammt.
Vor rund dreißig Jahren begann im Rahmen der FAO und anderer internationaler Foren die Diskussion darüber, daß die genetische Basis der Nutzpflanzen zu eng wird. Und, wie der Biologe Michael Flitner in seiner historischen Studie "Sammler, Räuber und Gelehrte" über die Machtinteressen um den Rohstoff der Pflanzenzüchtung nachweist, setzte sich zeitgleich der ökonomisch geprägte Begriff der "genetischen Ressourcen" durch.
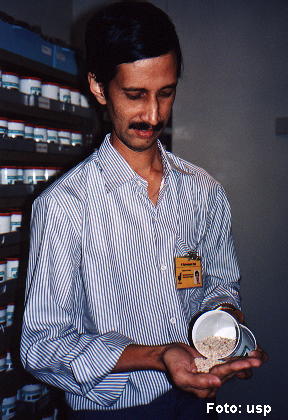 Um möglichst umfassende Kontrolle über Sammlungen dieses
Rohstoffes und deren landwirtschaftliche Nutzung zu erlangen, wurde schließlich im Jahr 1971 auf Empfehlung der Weltbank der Beratungsgruppe für Internationale Agrarforschung (CGIAR) gegründet. Unter diesem Dach fanden sich bis dahin privat finanzierte Agrarforschungsinstitute zusammen. CGIAR als
informeller Zusammenschluß privater und öffentlicher Institutionen, sollte für die rasche Verbreitung der Grünen Revolution und die Gründung weiterer Agrarforschungszentren sorgen. In dem Konsortium, dem bis heute 16 vor allem im Süden angesiedelte Agrarforschungszentren (IARC) inklusive
deren Genbanken angehören, dominierten stets die wirtschaftlichen Interessen des Nordens.
Um möglichst umfassende Kontrolle über Sammlungen dieses
Rohstoffes und deren landwirtschaftliche Nutzung zu erlangen, wurde schließlich im Jahr 1971 auf Empfehlung der Weltbank der Beratungsgruppe für Internationale Agrarforschung (CGIAR) gegründet. Unter diesem Dach fanden sich bis dahin privat finanzierte Agrarforschungsinstitute zusammen. CGIAR als
informeller Zusammenschluß privater und öffentlicher Institutionen, sollte für die rasche Verbreitung der Grünen Revolution und die Gründung weiterer Agrarforschungszentren sorgen. In dem Konsortium, dem bis heute 16 vor allem im Süden angesiedelte Agrarforschungszentren (IARC) inklusive
deren Genbanken angehören, dominierten stets die wirtschaftlichen Interessen des Nordens.
Allerdings waren die Besitzrechte an dem gesammelten und eingelagerten Material nie wirklich geklärt. Erst im Jahr 1994, nachdem die Weltbank handstreichartig versucht hatte, sich des Schatzes - den Kollektionen von mehr als einer halben Million Proben Keimmaterial von Nutzpflanzen - zu bemächtigen, wurden die Sammlungen der Schirmherrschaft der FAO unterstellt.
Die Pflanzenzüchtung, seit Jahrtausenden in den Händen von bäuerlichen Gemeinschaften ging seit der Wiederentdeckung der Mendelschen Erbgesetzte um die Jahrhundertwende zunehmend in die Labore von WissenschaftlerInnen über. "Aus den regionaltypischen Land- oder Lokalsorten wurden mit Hilfe gezielter und neu entwickelter Züchtungsmethoden Sorten mit ständig steigenden Ertragspotentialen hervorgebracht", erklärt die deutsche Agraringenieurin Gabriele Blümlein. Die mittlerweile entstandene Saatgutbranche macht damit alljährlich Millionengewinne. Doch nach wie vor tun sich Politik, Wissenschaft und Industrie schwer damit anzuerkennen, daß der unschätzbare Reichtum an Biodiversität auf dem die modernen Neuzüchtungen basieren, untrennbar verbunden ist mit dem überlieferten Wissen der Menschen, die diese Pflanzen vor Ort (in-situ) nutzen, sie bewahren und verbreiten.
Diese züchterischen und landwirtschaftlichen Leistungen, von Nicht-Regierungsorganisationen (NRO) aus dem Süden als "indigenes Wissen" bezeichnet, wurden und werden von der Agrar-Lobby als "naiv" oder gar als "Quacksalberei" abgewertet, berichtet der Rural Advancement Fund International (RAFI). Diese Nicht-Regierungsorganisation macht Lobby-Arbeit in Fragen der Biodiversität und intellektueller Eigentumsrechte.
Trotz existierender Abkommen ist bislang noch offen, wie ein solcher Anspruch von Individuen, Gruppen oder auch von Staaten auf einem zunehmend liberalisierten Weltmarkt, der lokale Bedürfnisse, soziale und kulturelle Erwägungen und Umweltfragen den Bedingungen transnationaler Konzerne unterordnet, eingelöst werden soll.
Nicht-Regierungsorganisationen wie RAFI, oder das in Malaysia ansässige Third World Network und die Initiative Genetic Resources Action International (GRAIN) mit Sitz in Barcelona suchen nicht nur nach Wegen für den Erhalt der biologischen Vielfalt. Sie bewegt vielmehr, wie die Rechte bäuerlicher und indigener Gemeinschaften gestärkt werden können. Dazu gehört die Frage, wie die Kontrolle über die Nutzung lokaler oder regionaler Biodiversität, ebenso wie das vorhandene Wissen darüber in den Händen dieser Gemeinschaften verbleiben kann.
Abdruck (auch auszugsweise), Vervielfältigung, Zitat nur in Absprache mit der Autorin.