Forum |
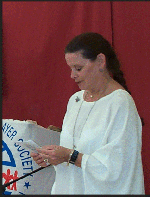 Hagit Ra`anan
Hagit Ra`anan
Hagit lebt in der Nähe von Tel Aviv. 1923 kam ihre Familie aus Polen nach Israel. "Mein Großvater hatte das Gefühl, dass etwas Schlimmes kommen würde und er seine Familie in Sicherheit bringen müsste. Die Schwester meiner Großmutter kam nicht mit - sie überlebte den Holocaust nicht. 1946 waren meine Eltern in der Untergrundbewegung "Etzel/Irgun"; meine Mutter war mit meiner älteren Schwester, die ein Jahr alt war, für ein Jahr im Gefängnis. Mein Vater wurde ein Kommendeur dieser Bewegung; es war eine rechte Bewegung. Schlimme Dinge sind geschehen in dieser Zeit. Aber ich muss sagen, ich liebe meinen Vater trotz allem sehr. 1962 war meine Bat Mitzvah. Die Altstadt von Jerusalem war durch Jordanien besetzt. Das Geschenk meines Vaters war, dass er mich mitnahm, um die Klagemauer zu berühren. Er brachte mich nach Jerusalem auf die andere Seite eines Zauns. Auf allen Dächern standen Scharfschützen; es war verboten, auf die andere Seite zu gehen. Mein Vater sagte mir: "Auch wenn es dein Leben kostet, ich möchte, dass du rennst, die Mauer berührst und dann zurückkommst. Das ist mein Geschenk für dich."
Im Alter von 32 Jahren hatte ich 6 Kriege erlebt und nur wenige Tage des Friedens. Während der Kriege habe ich Freunde verloren, in der Schule und der Armee. Ich selbst war in der Armee, teilweise auf dem Gazastreifen.
Das schlimmste, was ich erlebte, geschah im Juni 1982. Während der ersten Woche des Libanon-Krieges verlor ich meinen Lebenspartner. Er wurde von einem Palästinenser nahe Beirut erschossen. In dieser Zeit war ich im fünften Monat schwanger. Der Schmerz war so überwältigend, dass ich dachte, es wäre das Ende meines Lebens. Ich verließ den Friedhof überhaupt nicht mehr. Eines Morgens fand man mich dort auf dem Boden: ich hatte eine Fehlgeburt. Es war, als hätte ich das Kind seinem Vater zurückgegeben.
Trotz allem, was ich erlebt habe, sage ich: ich gebe niemandem die Schuld. Ich bin kein Opfer, und ich glaube nicht, dass irgend jemand von uns Opfer ist. Ich merkte, um weiterleben zu können, muss ich etwas tun. Ich werde die Erinnerung an das bewahren, was geschehen ist, aber nur, damit es mich motiviert, in eine positive Richtung zu gehen. Meine Arbeit hat nichts mit Politik zu tun. Ich komme als Mensch, um andere Menschen zu unterstützen, die sich selbst helfen wollen. Ich glaube nicht, dass ich besser bin als irgendjemand anders, aber ich habe mehr Freiheit. In meiner Sicht gibt es unendlich viel Angst im Nahen Osten, in Palästina und Israel. Die Palästinenser sind die Juden der arabischen Welt. Niemand schert sich wirklich um die Juden oder die Palästinenser. Mein Verständnis ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen, dass wir zusammen sein müssen - das ist die einzige Wahl, die wir haben. Wir müssen die Angst loswerden. Es spielt keine Rolle, wer mehr leidet - im Moment leiden beide. Um die Angst loszuwerden, müssen wir uns treffen und miteinander sprechen.
Bis Oktober 2000 habe ich Israelis und Palästinenser zusammengebracht, um zu sprechen. Ich brachte Israelis über das Wochenende in den Gaza Streifen, damit sie sahen, was die Palästinenser aufgebaut haben. In Israel gelten die Palästinenser entweder als Terroristen oder als Menschen, die schlechtere Jobs übernehmen. Aber im Gaza hatten sie schöne große Orte aufgebaut, Hotels, Flughäfen, Kultur- und Rehabilitationszentren. Ich wollte auch, dass sie sehen, dass die Millionen Einwohner des Gazastreifens auf einem Drittel der Fläche lebten, während der Rest von 12.000 Siedlern bewohnt wurde.
Seit Oktober 2000 kann ich meine Freunde nicht mehr dorthin bringen. Das ist ein großer Verlust für mich. Nach meinen persönlichen Verlusten habe ich mich wie eine Mutter für alle Kinder der Erde gefühlt. Und es gibt viele Kinder im Gaza-Streifen und in der Westbank, die mich Ima nennen. Ima heißt auf hebräisch Mama.
Und so habe ich bei jeder Terrorattacke einen doppelten Schmerz: um die Israelis, die verwundet oder getötet werden, und zur gleichen Zeit weiß ich, dass meine "Kinder" unter der Rache leiden werden. Ich verbringe viele Stunden damit, mit ihnen zu telefonieren und ihnen zuzuhören. Ich arbeite daran, verwundeten Kindern medizinische Hilfe zukommen zu lassen.
Ein Kind, das nach einem Schuss eines Soldaten beinahe sein Augenlicht verloren hatte, konnten wir durch eine Operation retten. Ich besuchte es im Krankenhaus und brachte ihm Süßigkeiten und Kleider. Er war über die Süßigkeiten glücklicher als über die Kleider. Er fragte seine Mutter: "Yama, ist sie eine Jüdin, eine Israelin?" Das brach mir das Herz - gab mir aber auch ein Verständnis davon, wie die Palästinenser uns Juden sehen.
Aber nicht alle Israelis sind Besetzer oder Siedler. Und nicht alle Palästinenser sind Selbstmordattentäter. Es gibt so viele schöne Menschen auf beiden Seiten, die wirklich den Frieden wollen, die alles tun, was sie können."
