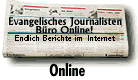|
|
1948 war das "Jahr der Heimkehr" - bis zum Jahresende sollten auf Beschluß der Siegermächte alle deutschen Kriegsgefangenen zurückkehren. Die Sowjetunion erklärte jedoch alle danach verbliebenen Kriegsgefangenen zu "Kriegsverbrechern", die ihre Schuld am russischen Volk durch Arbeitseinsätze abarbeiten müßten. Erst durch die diplomatische Intervention Adenauers kehrten die letzten Gefangenen 1955 zurück. Frankfurt/ Oder war zu jener Zeit der zentrale Knotenpunkt des Gefangenen-Austausches im Osten. Neben mehreren Millionen Heimatvertriebenen kamen etwa 3 Millionen Wehrmachtsangehörige durch die Stadt nach Deutschland zurück. Familiendramen, Entwurzelung, Perspektivlosigkeit - das alles sammelt sich in Frankfurt/Oder wie unter einem Brennglas. 50 Jahre später erinnert eine Ausstellung in der Frankfurter Marienkirche an diese Zeit. Fotos, Videoprojektionen damaliger Wochenschauen und Hörinstallationen lassen den Besucher die Geschichte der Kriegsheimkehrer nochmals lebendig werden. Die promovierte Historikerin Annette Kaminsky beschäftigt sich schon seit langem mit der Rückführung der Soldaten und Internierten nach dem Zweiten Weltkrieg. "Man muß sich das heute noch mal klar machen. Die Soldaten gingen als Helden und kamen nach Jahren als Verlierer in ein verändertes Deutschland zurück. Die Heimkehrer kannten die Heimat nicht mehr, und die Heimat kannte die Heimkehrer nicht mehr!" erklärt Annette Kaminsky. Im Lager Frankfurt-Gronenfelde wurden aus Millionen Soldaten Zivilisten. In 24 Stunden wurden sie durchgeschleust: Entlausung, medizinische Erstuntersuchung, Suchdienst, die erste Post nach Hause. Tausende haben diesen ersten Tag in der Freiheit nicht mehr überlebt, sie starben noch in Frankfurt an Krankheit und Erschöpfung. Die Kirche bot den Kriegsheimkehrern erste Hilfe an. Auf dem Bahnhof Frankfurt/ Oder verteilte das Diakonische Werk warme Getränke und ersten Zuspruch: ihr habt's bald geschafft. Aus dem Aufnahmelager Gronenfelde wurden die Diakonissen des Martin-Luther-Stift bald von der SED verbannt, weil sie angeblich den Ablauf des Lageralltags störten. Eine Diakonissin, die schon damals in der Oderstadt Dienst tat, versichert, daß die Partei jedoch insgeheim über jede helfende Hand froh war. Die russischen Soldaten haben die Diakonissen mit Lebensmitteln versorgt und ihnen Respekt entgegengebracht. Aber offiziell stand die Arbeit der Diakonissen in Konkurrenz zur SED. Die Volkssolidarität, die damals in der SBZ (Sowjetisch Besetzten Zone) gegründet wurde, und auch die Parteien riefen immer wieder zu Sammlungen auf: Kleiderspenden, Nahrungsmittelspenden. Sie hatten aber nicht soviel Erfolg wie die Spendenaufrufe der Kirchen, die am Sonntag nach den Gottesdiensten verlesen wurden. Es wurden auch mehrmals jährlich Gebetswochen für die Kriegsgefangenen durchgeführt. Die Diakonissen versorgten die Schwerstkranken in den Krankenhäusern. Zur seelsorgerlichen Betreuung der Heimkehrer stellten die katholische und evangelische Kirche in Frankfurt/ Oder je einen ehemaligen Wehrmachtspfarrer ab. Diese Pfarrer hatten selbst die Kriegsgefangenschaft erlebt und brachten Verständnis und Wissen um die in den Lagern erlebten Zustände mit. "Nur die eine Erwägung, daß derselbe Mensch, der jetzt Erholung, geistige Erneuerung und viel Liebe bräuchte, um das verlorene Menschentum wiederzugewinnen, ringsum eine zerstörte und völlig lieblos gewordene Welt antrifft, genügt, um die bittere innere Not eines Heimkehrers zu erfassen." schreibt Annette Kaminsky in ihrem die Ausstellung begleitenden Buch. Die Menschenströme liefen aber auch in umgekehrter Richtung durch die Oderstadt: von West nach Ost. 5000 Wehrmachtsoffiziere wurden nach der Entlassung aus amerikanischer Gefangenschaft im Sommer 1946 in die Sowjetunion verbracht. 20.000 Deutsche aus sowjetischen Speziallagern in der SBZ wurden in den Osten deportiert. Hunderttausende kriegsgefangene Polen kamen über Frankfurt in ihr neu aufgeteiltes Land. Über 5 Millionen Sowjetsoldaten warteten auf ihre Entlassung, die Repatriierung . Doch nach einem alten Stalin-Befehl sollten alle Russen mit Feindkontakt ihre Bürgerrechte verlieren. In den Lagern, in denen sie gesammelt waren, brachen Massenpaniken aus, es gab Fälle von Massenselbstmorden. Die gefangenen Sowjetsoldaten wollten auf jeden Fall verhindern, an die Russen übergeben zu werden. Die Stalin-Regierung versicherte zwar öffentlich, daß den Rotarmisten nichts geschehen würde. Doch diese kamen in Filtrationslager, wurden dort bewertet, auf sie wartete die Verbannung, Gulag oder die Nachverurteilung durch ein Gericht. Im kalten Krieg wurde die Kriegsheimkehrer-Problematik auf beiden Seiten instrumentalisiert. So klagte der Westen die Unmenschlichkeit russischer Kriegsgefangenschaft an. Der Osten stellte die glücklichen Heimkehrer als Beweis der deutsch-sowjetischen Freundschaft ins Rampenlicht. Heute weiß man, daß die fröhlichen Gesichter in den Wochenschauen oft nicht die Realität wiederspiegelten. "Natürlich waren sie für die Gesellschaft erst mal Außenseiter. Sie wurden über ihr erbärmliches Äußeres wahrgenommen, sie wurden als Sozialfälle wahrgenommen. Der Kriegsheimkehrer ist eine typische Sozialfigur der Nachkriegszeit, nicht arbeitsfähig, unterernährt, mit seelischen Problemen belastet, die doch für den Großteil der Gesellschaft nicht ihre Probleme waren. Für mich ist deutlich geworden, daß die politische Instrumentalisierung der gesamten Gruppe Vorrang vor einer tatsächlichen Aufarbeitung ihrer Traumatisierungen und ihrer Beschädigungen hatte." faßt Annette Kaminsky zusammen. Heimkehr 1948, Annette Kaminsky (Hrsg), 400 Seiten, 82 Abbildungen, gebunden, 38 DM, C.H.Beck München, Oktober 1998, ISBN 3-406-44201-3 |